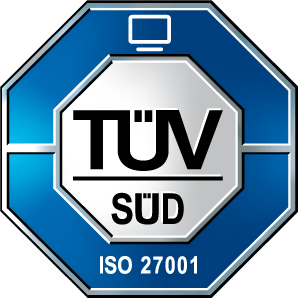Schutz für Hinweisgeber
Richtlinie zum Schutz der Hinweisgeber
Deutschland musste die EU-Whistleblowing Richtlinie umsetzen. Die Umsetzungsfrist lief bis zum 16. Dezember 2021. Da die Richtlinie nicht rechtzeitig in nationales Recht umgesetzt wurde, galt die EU-Whistleblowing Richtlinie in weiten Teilen unmittelbar.
Am 02. Juli 2023 ist dann das nationale Gesetz zum besseren Schutz von hinweisgebenden Personen – Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) in Kraft getreten.
Der Schutz für Hinweisgeber ergibt sich seitdem direkt aus dieser Richtlinie. Zuerst muss der sachliche Anwendungsbereich eröffnet sein, das bedeutet: Vom Schutz der Richtlinie sind die Meldung und die Offenlegung von Informationen über Verstöße, die strafbewehrt sowie Verstöße, die bußgeldbewehrt sind und weitere in § 2 HinSchG genannte Verstöße gegen Rechtsvorschriften.
Hinsichtlich des persönlichen Anwendungsbereichs schützt die Richtlinie „hinweisgebende Personen“ als (sämtliche) natürliche Personen, die im Zusammenhang mit ihrer beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit Informationen über Verstöße erlangt haben und diese an die nach diesem Gesetz vorgesehenen Meldestellen melden oder offenlegen.
Der Kern des Hinweisgeberschutzes ist der anti-diskriminierungsrechtlich ausgestaltete Schutz von Hinweisgebern.
Diese werden umfassend vor sämtlichen aufgrund des Whistleblowings veranlassten Repressalien geschützt, seien diese nun arbeits-, beamten-, zivil-, verwaltungs- oder strafrechtlicher Natur. In diesem Sinne sind Repressalien sämtliche durchgeführten, versuchten oder angedrohten „Handlungen oder Unterlassungen im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit, die eine Reaktion auf eine Meldung oder Offenlegung sind und durch die der hinweisgebenden Person ein ungerechtfertigter Nachteil entsteht oder entstehen kann“.
Neben der Eröffnung des sachlichen und persönlichen Anwendungsbereichs ist der wesentliche Anknüpfungspunkt des Hinweisgeberschutzes das Vorliegen einer Meldung oder Offenlegung über einen Regelverstoß. Die Richtlinie definiert als Weitergabe von Informationen über Verstöße an eine interne oder externe Meldestelle bzw. die öffentliche Zugänglichmachung dieser Informationen. Der Hinweisgeber darf dabei an eine interne Meldestelle melden oder sich direkt an eine externe Meldestelle wenden. Hierzu soll eine zentrale externe Meldestelle des Bundes eingerichtet werden.