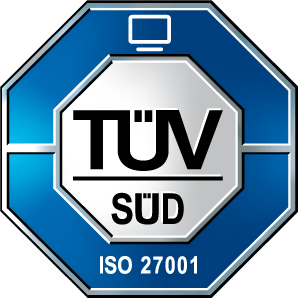Am 19. Februar 2025 hat das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) eine neue Leitlinie zur risikobasierten Umsetzung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) herausgegeben. In den dazugehörigen FAQ gibt die Behörde Unternehmen praktische Hinweise dazu, wie sie Risiken identifizieren, priorisieren und im Umgang mit ihren Zulieferern gezielt adressieren können.
Welche Unternehmen sind vom LkSG betroffen?
Seit 2024 verpflichtet das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) alle Unternehmen in Deutschland mit mehr als 1.000 Beschäftigten dazu, sicherzustellen, dass ihre Lieferketten frei von Menschenrechtsverletzungen und Umweltverstößen sind.
Auch kleinere Unternehmen sind betroffen
Das LkSG entfaltet zudem eine indirekte Wirkung: Viele Großunternehmen verlangen von ihren Zulieferern* und Geschäftspartnern, ebenfalls die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Unternehmen, die mit betroffenen Firmen kooperieren, müssen sich daher auf steigende Compliance-Anforderungen einstellen.
Weitere Informationen zum Lieferkettengesetz finden Sie auf der BAFA-Website oder direkt im LkSG-Gesetzestext.
Neue regulatorische Anforderungen: Was ändert sich?
Unternehmen sind verpflichtet, innerhalb ihrer Lieferketten menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken systematisch zu identifizieren, Maßnahmen zu implementieren und transparent darüber zu berichten.
Bislang war es gängige Praxis, standardisierte Fragebögen an sämtliche Zulieferer zu versenden – unabhängig von deren Risikoprofil. Dieses ineffiziente Vorgehen führte zu einem erheblichen administrativen Mehraufwand.
Neue BAFA-FAQ bieten Klarheit
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) hat im Februar 2025 neue FAQ zum risikobasierten Vorgehen veröffentlicht. Diese Leitlinien bieten Unternehmen praxisnahe Vorgaben für eine effizientere Umsetzung des LkSG.
Hier die aktuellen BAFA-FAQ abrufen
Die zentralen Neuerungen im LkSG 2025
Die überarbeiteten BAFA-FAQ spezifizieren, dass Unternehmen ihre Ressourcen gezielt auf die größten Risiken fokussieren dürfen – anstatt eine gleichmäßige Behandlung aller Zulieferer vorzunehmen.
Wesentliche Änderungen im Überblick:
- Abschaffung standardisierter Fragebögen: Die Auswahl der Zulieferer erfolgt nun auf Grundlage einer differenzierten Risikobetrachtung. Eine einheitliche Befragung aller Lieferanten ohne vorherige Risikoanalyse ist nicht mehr zulässig.
- Vierstufige Risikoanalyse als Standard:
- Erfassung der Lieferkettenrisiken: Welche potenziellen Risiken bestehen?
- Identifikation kritischer Branchen und Regionen
- Detaillierte Prüfung relevanter Zulieferer
- Priorisierung der dringendsten Handlungsfelder
- Gezielte Fokussierung auf Hochrisikobereiche: Unternehmen sind nicht verpflichtet, sämtliche Zulieferer zu analysieren, sondern sollen sich auf die signifikantesten Risiken konzentrieren.
- Erhöhte Prüfungsintensität durch das BAFA: Unternehmen, die Risiken ignorieren oder ihre Sorgfaltspflichten an Zulieferer delegieren, müssen mit Sanktionen und Bußgeldern rechnen.
Hinweis: Die BAFA-Überprüfung der LkSG-Berichte beginnt offiziell erst im Jahr 2026. Unternehmen sollten sich jedoch frühzeitig auf verschärfte Prüfmechanismen vorbereiten.
Strengere Kontrollen: Welche Risiken bestehen für Unternehmen?
Die überarbeiteten BAFA-FAQ dienen nicht nur als Orientierungshilfe, sondern signalisieren auch eine Verstärkung der behördlichen Kontrollen.
Wichtig: Zulieferer können künftig anonyme Beschwerden beim BAFA einreichen. Unternehmen, die ihre Zulieferer ohne fundierte Risikoanalyse befragen, riskieren entsprechende Meldungen.
BAFA-Kontakt für Beschwerden: LKSG.Kontrolle@bafa.bund.de
Auswirkungen auf betroffene Unternehmen
- Jede anonyme Beschwerde kann eine BAFA-Prüfung auslösen.
- Das BAFA kann eine schriftliche Auskunftsanfrage an das Unternehmen richten.
- Unternehmen, die kein risikobasiertes Vorgehen nachweisen können, müssen mit Bußgeldern rechnen.
- Selbst wenn Sanktionen später entfallen, verursacht eine behördliche Prüfung erheblichen Verwaltungsaufwand und potenzielle Reputationsrisiken.
Besonders risikobehaftet sind Unternehmen, die ihren Zulieferern unstrukturierte Fragebögen oder verpflichtende Verhaltenskodizes vorlegen. Diese Praxis kann eine umgehende behördliche Überprüfung nach sich ziehen.
Handlungsempfehlungen für Unternehmen
- Überarbeitung der Lieferkettenfragebögen
- Keine pauschalen Fragebögen mehr!
- Anpassung der Abfragen an spezifische Risikoprofile.
- Optimierung des Risikomanagements
- Detaillierte Dokumentation der Risikoerfassungs- und Priorisierungsprozesse.
- Fokussierte Präventionsmaßnahmen
- Umsetzung gezielter Maßnahmen für identifizierte Hochrisikobereiche.
- Interne Schulungen für relevante Abteilungen
- Einkauf und Compliance-Teams sollten frühzeitig über die neuen BAFA-Vorgaben informiert werden.
Fazit: Frühzeitiges Handeln minimiert Risiken!
Die neuen BAFA-FAQ setzen deutlich höhere Anforderungen an die Compliance-Strategien von Unternehmen. Standardisierte Prüfverfahren ohne fundierte Risikoanalyse sind nicht mehr rechtskonform. Unternehmen sollten daher ihre internen Prozesse frühzeitig anpassen, um behördliche Sanktionen und wirtschaftliche Risiken zu vermeiden.
Proaktive Compliance-Maßnahmen sichern langfristige Rechtssicherheit und minimieren unternehmerische Haftungsrisiken.
Sprechen Sie mit unseren Experten – unverbindlich und kostenlos. Ihr Ansprechpartner: Dr. Maximilian Degenhart:
E-Mail
Telefon: 089 2152 7445
Termin buchen
Autor: RA Dr. Maximilian Degenhart, Geschäftsführer Hinweisgeberexperte. Der Compliance Dienstleister Hinweisgeberexperte berät Mandanten bei der Einrichtung von Hinweisgebersystemen und nimmt Aufgaben von internen Meldestellen wahr. Wir betreiben Hinweisgebersysteme für mittelständische Unternehmen, börsennotierte Konzerne, Landkreise, Kommunionen und öffentliche Unternehmen.
Informationen zum Hinweisgeberschutzgesetz
Weitere Informationen zum Hinweisgeberschutzgesetz finden Sie auf unserer Homepage und auf unserem YouTube-Kanal:

*Zur besseren Lesbarkeit verzichten wir auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.